Open Access 2023 | Open Access | Buch
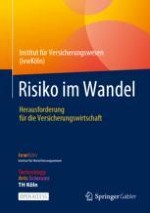
Risiko im Wandel
Herausforderung für die Versicherungswirtschaft
herausgegeben von: Rolf Arnold, Marcel Berg, Oskar Goecke, Maria Heep-Altiner, Horst Müller-Peters
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Open Access 2023 | Open Access | Buch
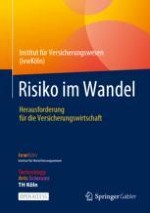
herausgegeben von: Rolf Arnold, Marcel Berg, Oskar Goecke, Maria Heep-Altiner, Horst Müller-Peters
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Dieses Open-Access-Buch bietet einen umfassenden Überblick über Lösungsansätze, mit denen die Versicherungswirtschaft den wesentlichen Herausforderungen und Megatrends der heutigen Zeit begegnen kann. Es handelt sich also um eine umfangreiche Momentaufnahme der Auseinandersetzungen mit relevanten Forschungsfragen zu den Risiken im Bereich des Versicherungsgeschäfts. Dabei kommen die Sichtweisen von Juristen, Mathematikern, Wirtschaftswissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern und Ingenieuren zum Ausdruck, um der Vielschichtigkeit der Thematik gerecht werden zu können. Die Besonderheit des geplanten Werkes liegt in der Breite an abgedeckten versicherungsspezifischen Themengebieten. Somit bietet der Band für verschiedene Zielgruppen aus Praxis, Wissenschaft und Politik Antworten auf bedeutende aktuelle Fragestellungen. Die einzelnen Beiträge sind dabei in vier Themengebiete geordnet. Das Themengebiet „RISIKO IM WANDEL“ beschäftigt sich mit vielen Themen, welche in den kommenden Jahren Gegenstand der politischen und gesellschaftlichen Debatte sein werden. Dazu gehört der Klimawandel, die Zukunft der Pflegeversicherung oder der Betrieblichen Altersversorgung. Die ökono-mischen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie werden ebenso thematisiert. Im Bereich „RISIKEN KALKULIEREN UND MANAGEN“ widmen sich die Beiträge den Grenzen der Versicherbarkeit und einer veränderten Sichtweise auf das Sicherheitsversprechen der Versicherungswirtschaft. Zudem wird diskutiert, wie Cyber-Kumulschäden von Erst- und Rückversicherern beherrscht werden können. RISIKO UND RECHT fokussiert auf juristische Aspekte zu Themen wie die Elementarschadenversicherung, die betriebliche Altersversorgung oder autonomes Fahren. Der vierte Abschnitt diskutiert die HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT in den Bereichen Personal, Vertrieb, Führung, Steuerung und Change-Management. Der Sammelband blickt in einem abschließenden Artikel mit einer humoristischen Sichtweise auf „DIE ARCHE NOAH AUS DER SICHT DER SEEKASKO“.
Dies ist ein Open-Access-Buch.